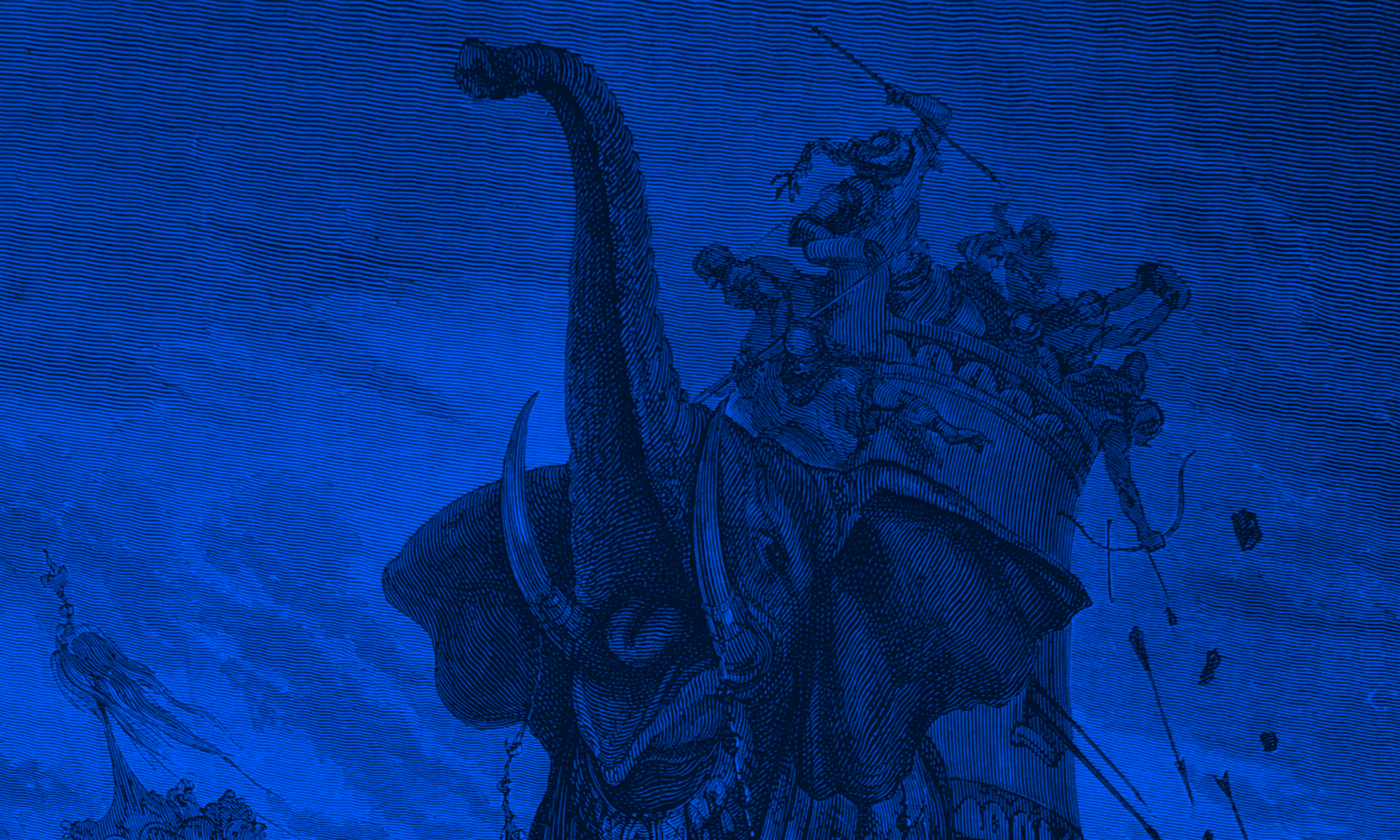Sonnabend, 17. November 2018, 10:30–12:00 Uhr
Sektion I: Relationen
Historisierung oder Begegnung? Differenzhistorisch – Differenzphilosophisch. Kunstgeschichte in künstlerischer Bildung
Prof. Dr. Carl-Peter Buschkühle (Universität Gießen), Moderation: Prof. Dr. Ulrich Heinen
Sektion II: Schnittstellen
Digitale Phänomene und Geräte in bild- bzw. kunstgeschichtlichen Zusammenhängen – Beispiele aus dem Kunstunterricht in den Arbeitsbereichen Fotografie und Film
Klaus Küchmeister
[expand title=“mehr“ swaptitle=“weniger“]Die Geschichtlichkeit von Bildern spielt im Kunstunterricht immer eine zentrale Rolle. Dabei stellen sich in der unterrichtlichen Praxis gleich mehrere kunstdidaktische Fragen:
- In welchem Umfang soll das geschehen?
Wie kann eine sinnvolle Verbindung von historischer Bildanalyse und der eigenen, aktuellen Bildproduktion aussehen?
In welchem historischen Verhältnis stehen eigentlich analoge und digitale Medien?
Vor diesem Hintergrund werden Aufgabenstellungen und Unterrichtsergebnisse vorwiegend aus den Arbeitsbereichen Fotografie und Film vorgestellt und diskutiert. Sie greifen die Geschichtlichkeit von Medienphänomenen wie „Handyfilm“ und „Selfie“ auf und berücksichtigen historische Parallelen bei der Einführung damaliger, neuer Medien (z. B. Fotoapparat, Filmkamera) zu heutigen digitalen Medien (z. B. Smartphone). Es wird das „Prinzip Hommage“ als sinnvolle Methode des „Sich-Ausdrückens in und mit Bildern“ in der Auseinandersetzung mit historischen Vorbildern erläutert.[/expand]
Sektion III: Rezeptionsangebote
KLÄREN – Digitale Medien nutzen – 3D-Modellierung des Klärens und (Nach-)Gestaltens barocker Architektur
Impulsreferate/Leitung: Dr. Ute Engel (Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Kunstgeschichte) und Dr. Karin Guminski (Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Kunstpädagogik, Kunst und Multimedia)
[expand title=“mehr“ swaptitle=“weniger“]Die Kammerkapelle der Kurfürstin im Neuen Schloss Schleißheim in 3D. Ein Bericht über eine fächerübergreifende Lehrveranstaltung der Institute für Kunstgeschichte und Kunstpädagogik der LMU (in Kooperation mit dem V2C des Leibniz-Rechenzentrums).
Workshop: Im Workshop werden Möglichkeiten für den schulischen Bereich zum Thema 3D-Rekonstruktion von historischer oder bestehender Architektur diskutiert. Dabei sollen sowohl die kunsthistorische Sichtweise als auch kunstpraktische Aspekte berücksichtigt werden. Eine einfache Methode der 3D-Digitalsierung vorhandener Architektur werden wir als Demo vorführen.[/expand]
Sektion IV: Auswahlstrategien
Zur fachdidaktischen Relevanz und Produktivität von praktisch-rezeptiven Methoden der Werkanalyse
Katrin Dropczynski, Marcus Nümann
Sektion V: Positionsveränderungen
Filme über Kunst im Kunstunterricht
Dr. Friederike Rückert
Der kunsttheoretische Ansatz Günther Regels im Spiegel aktueller Entwicklungen kunsthistorischer, kunsttheoretischer und kunstpolitischer Debatten und Auseinandersetzungen
Dr. Thomas Klemm
Sektion VI: Fokussierung
Performative Strategien als fokussierte Streuung
Marit van der Woude, Christopher Utpadel
Sektion VII: Lernortwechsel
Kunstvermittlung mit dem Original – Architektur als Referenz
Alan Brooks/Petia Knebel/Rainer Wenrich, Ort: Neubau der AdBK
Parallel:
Performative Begegnung mit Kunst- und Kulturgeschichte
Anna Beke, Ort: Residenz München
Sektion VIII: Interdisziplinarität
Nachdem in Leipzig die Fächer Deutsch, Geschichte, Religion und Kunst ihre Expertisen zum Medium Bild vorstellten, soll in München deutlicher der überfachliche Bezug als Bildungsauftrag herausgearbeitet werden:
Das Bild als universelles Erschließungsmedium von Wirklichkeit im interdisziplinären Vergleich
[expand title=“mehr“ swaptitle=“weniger“]Folgende Fragen strukturieren den Workshop:
- Wie können Bilder in ihrer Konstruktivität im Sinne des Herstellens einer eigenen medialen Wirklichkeit thematisiert werden?
- Welchen Stellenwert haben formale Voraussetzungen wie Material, Komposition, Form-, Farbe- Raumauffassung etc. im Sinne des Gemachtseins von Bildern in den Fächern?[/expand]
Sektion IX: Transkulturelle Prozesse
Das Projekt „museum global“ und die Frage nach den Künstlerinnen der Nigerianischen Moderne
Dr. Isabelle Malz (Kuratorin, Kunstsammlung des Landes NRW)
[expand title=“mehr“ swaptitle=“weniger“]Die Referentinstellt zunächst das breit angelegte Projekt „museum global“ in der Kunstsammlung des Landes Nordrhein-Westfalen vor, das nach globalgeschichtlichen Perspektiven auf die Moderne und nach Möglichkeiten kritischer, global geöffneter Präsentation und Vermittlung in Sammlungen fragt. Hiervon ausgehend stellt sie als Beispiel außereuropäischer Zentren der modernen Kunstproduktion fernab des tradierten europäischen Kanons nigerianische Künstlerinnen vor, wodurch zusätzlich eine feministische Perspektive auf die Frage nach der kritischen Vermittlung von Kunstgeschichte eröffnet wird.[/expand]
Sektion X: Elementarpädagogik
Historisches Lernen anhand von vergleichenden Zugängen zu Bilderbuchillustrationen eines Themas
Prof. Dr. Gabriele Lieber (FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz)
[expand title=“mehr“ swaptitle=“weniger“]Kann historisches Lernen in der Kunstpädagogik auf der Elementar- und Primarstufe durch vergleichende Betrachtung von Bilderbuchillustrationen zu einer bekannten Narration gelingen. Am Beispiel des Märchens zum Rotkäppchen werden mögliche Zugangsweisen und Bildungsmomente aufgezeigt.
Moderation: Bettina Uhlig, Roland Karl Metzger[/expand]
Sektion XI: Diversität und Inklusion
In dieser Sektion gibt es keine strenge Unterteilung in Panels. Die Sektionsleiter bilden mit den TeilnehmerInnen und ReferentInnen ein gemeinsames Arbeits- und Diskussionsforum.
Impulsreferate: Thomas Röske, Susanne Liebmann-Wurmer, Andreas Brenne/Michaela Sindermann und Susanne Bauernschmitt/Teresa Sansour
[expand title=“mehr“ swaptitle=“weniger“]Eine Gerüst bilden folgende Fragen :
- Welche Impulse können aus der sogenannten Outsider Art, der Kunst von Menschen am Rand der Gesellschaft, zu der auch Kunstwerke von Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung zählen, für die Kunstpädagogik gewonnen werden?
- Kann Outsider Art ein Gegenstand des Kunstunterrichts sein und in welchem Kontext sollte dieser vermittelt werden?
- Inwieweit lässt sich das Fremde, das sich uns immer wieder entzieht, herausfordert und oft sprachlos zurücklässt, für ein gelingendes Unterrichtsgeschehen impulsreich annehmen?
- Wie lassen sich künstlerische Denk- und Handlungsfelder eröffnen, die individuellen Weltsichten in einer im besten Sinn geteilten Welt Raum geben?
- Wie verhalten sich Offenheit und Lernzielorientierung, geteilte Erfahrung und Wissens- bzw. Kompetenzvermittlung in inklusive Settings zueinander?
Susanne Bauernschmitt stellt gemeinsam mit Teresa Sansour entwickelte didaktische und methodische Perspektiven auf inklusiven Kunstunterricht aus kunstpädagogischer und sonderpädagogischer Sicht vor. Ausgangspunkt hierfür sind verschiedene inklusive Kunstprojekte aus Schule und Hochschule, bei denen – im Sinne einer künstlerischen Kunstpädagogik – das Subjekt im Mittelpunkt steht und eigenständige Bildungsprozesse an und mit der Kunst ermöglicht wurden.
Andreas Brenne untermauert die Reflexion der Begegnung mit dem Fremden als zentrale pädagogische Idee und wird Brücken zwischen Theorie und konkreter inklusiver Unterrichtspraxis vorstellen. In diesem Kontext werden Erkenntnisse aus einer aktuellen empirischen Studie von Michaela Sindermann (Universität Paderborn) zu den Überzeugungen von Kunstlehrkräften im Hinblick auf inklusive Lernarrangements vorgestellt. Dabei sollen Problemzonen des Transfers inklusiver Positionen in den Regelunterricht herausgearbeitet und Lösungsmöglichkeiten diskutiert werden.
Susanne Liebmann-Wurmer wird den Blick auf feine Töne der bildgetragenen zwischenmenschlichen Begegnung lenken und im Hinblick auf unsere Fragestellungen Möglichkeiten des sensiblen Umgangs mit unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Darstellungsweisen skizzieren.[/expand]